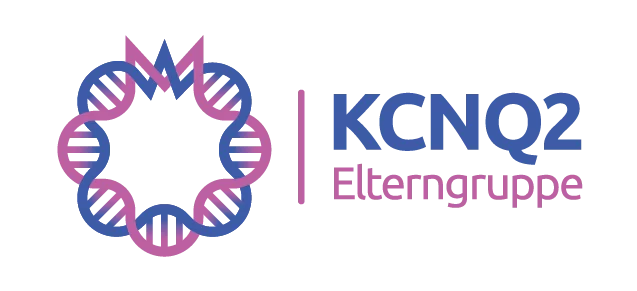Sarah Weckhuysen, MD, PhD, Associate Professor, Universität Antwerpen (Belgien)
Zusammenfassung zum Stand (01/2025) der Forschung
Klinische Projekte zur besseren Einschätzung der Unterschiede zwischen Kindern mit KCNQ2 Genmutationen und zur Verbesserung der Beratung von Familien hinsichtlich der Prognose
Unsere Forschung konzentriert sich auf die Unterschiede, die bei Kindern mit KCNQ2-Mutationen beobachtet werden. Ziel ist es, die Entwicklung besser vorhersagen zu können und Familien genauere Informationen über die Prognose ihres Kindes bereitzustellen. Zwar zeigen viele Kinder mit KCNQ2-Mutationen innerhalb des ersten Lebensmonats epileptische Anfälle, doch gibt es erhebliche Unterschiede im Verlauf der Epilepsie und in der allgemeinen Entwicklung.
Die spezifische KCNQ2-Mutation spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Prognose, dennoch können sich die Verläufe selbst bei Kindern mit der gleichen Mutation stark unterscheiden. Um diesen Unterschieden besser begegnen zu können, untersuchen wir frühe klinische Anzeichen, die Rückschlüsse auf den Schweregrad der Erkrankung erlauben. So möchten wir Eltern besser informieren können, wenn sie mit der Diagnose einer KCNQ2-Mutation bei ihrem Kind konfrontiert werden.
Wir vermuten außerdem, dass neben der KCNQ2-Mutation selbst weitere Faktoren diese Unterschiede beeinflussen. Dazu gehören möglicherweise genetische „Modifikatoren“ (also andere Gene, die mit KCNQ2 interagieren) sowie Umweltfaktoren – wie z. B. bestimmte Medikamente zur Anfallsbehandlung. Indem wir diese Modifikatoren identifizieren, hoffen wir, neue Behandlungsstrategien zu entwickeln und die Versorgung zu verbessern.
Diese Studie ist noch im Gange, und eine Teilnahme ist weiterhin möglich. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, benötigen wir eine große Zahl an Teilnehmenden. Jede Person mit einer KCNQ2-Mutation ist willkommen. Für die Teilnahme sammeln wir detaillierte klinische Informationen (häufig mit Unterstützung der behandelnden Ärzt:innen) und idealerweise – aber nicht zwingend – eine DNA- oder Blutprobe.
Wenn ihr teilnehmen oder mehr über das Projekt erfahren möchtet, nehmt gern Kontakt mit dem Forschungsteam auf: kcnq2@uantwerpen.be
Forschungsprojekte zur Entwicklung neuer Therapien mit aus Stammzellen gewonnenen Nervenzellen
Wenn wir besser verstehen, wie KCNQ2-Mutationen die Funktion von Nervenzellen beeinflussen, können wir darauf aufbauend gezielt neue Therapien entwickeln und testen. Da es nicht möglich ist, direkt Gehirnzellen von Kindern mit KCNQ2 zu entnehmen, verwenden wir eine innovative Methode: die sogenannte induzierte pluripotente Stammzelltechnologie (iPSC). Dabei wird aus einer einfachen Blutprobe von Betroffenen eine Stammzelle erzeugt, die wir im Labor in Nervenzellen umwandeln.
Diese im Labor gezüchteten Nervenzellen erlauben es uns, die Auswirkungen der Mutation direkt in menschlichen Zellen zu untersuchen – ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Tierversuchen. Darüber hinaus entwickeln wir komplexere Strukturen, sogenannte Gehirn-Organoide, die das 3D-Umfeld des menschlichen Gehirns nachahmen.
Mit diesen Modellen erforschen wir, wie sich Nervenzellen mit KCNQ2-Mutationen von gesunden Zellen unterscheiden. Beispielsweise haben wir festgestellt, dass KCNQ2-Mutationen mit Funktionsverlust (loss of function) dazu führen, dass die Zellen übermäßig elektrisch aktiv werden – ein Zustand, den wir als „Übererregbarkeit“ bezeichnen. Varianten mit Funktionsgewinn (gain of function) hingegen machen die Zellen weniger aktiv.
Auf Basis dieser Erkenntnisse arbeiten wir an drei Ansätzen:
1. Testen von Wirkstoffen, die KCNQ2-Kanäle öffnen oder blockieren
Für loss of function-Mutationen suchen wir Substanzen, die den Kanal öffnen, für gain of function-Mutationen solche, die ihn blockieren. In Zusammenarbeit mit dem internationalen TREATKCNQ-Konsortium haben wir z. B. eine Verbindung identifiziert, die überaktive Nervenzellen beruhigt. Diese Substanz wurde bereits bei einer anderen Erkrankung getestet und als sicher eingestuft – das könnte die Entwicklung für die Anwendung bei KCNQ2 deutlich beschleunigen. Der Wirkstoff ist noch nicht auf dem Markt, aber wir führen Gespräche mit dem Hersteller, um eine klinische Studie für Kinder mit KCNQ2-Mutationen zu prüfen.
2. Entwicklung von Antisense-Oligonukleotiden (ASOs)
ASOs sind winzige Moleküle, die gezielt an KCNQ2-RNA binden. Dadurch kann die Menge an KCNQ2-Kanälen, die in den Nervenzellen produziert wird, reduziert werden. Dies ist insbesondere bei gain of function-Mutationen hilfreich, da so die übermäßige Hemmung reduziert werden kann. Erste Laborexperimente zeigen vielversprechende Ergebnisse. Der nächste Schritt ist, die Sicherheit der ausgewählten ASOs in einem ersten Test zu bestätigen.
3. Einsatz moderner Omics-Technologien zur Analyse von RNA und Proteinen
Mit sogenannten Omics-Methoden analysieren wir, welche RNA und Proteine von den gezüchteten Nervenzellen und Gehirn-Organoiden produziert werden. Dadurch erhalten wir tieferes Verständnis dafür, wie KCNQ2-Mutationen zu neuroentwicklungsbedingten Problemen führen. Mithilfe computergestützter Verfahren nutzen wir diese Daten, um nach bereits zugelassenen Medikamenten zu suchen, die sich für eine neue Anwendung bei KCNQ2 eignen könnten (Drug Repurposing). Unser Ziel ist es, neue Therapien möglichst schnell und sicher zu den betroffenen Kindern zu bringen.